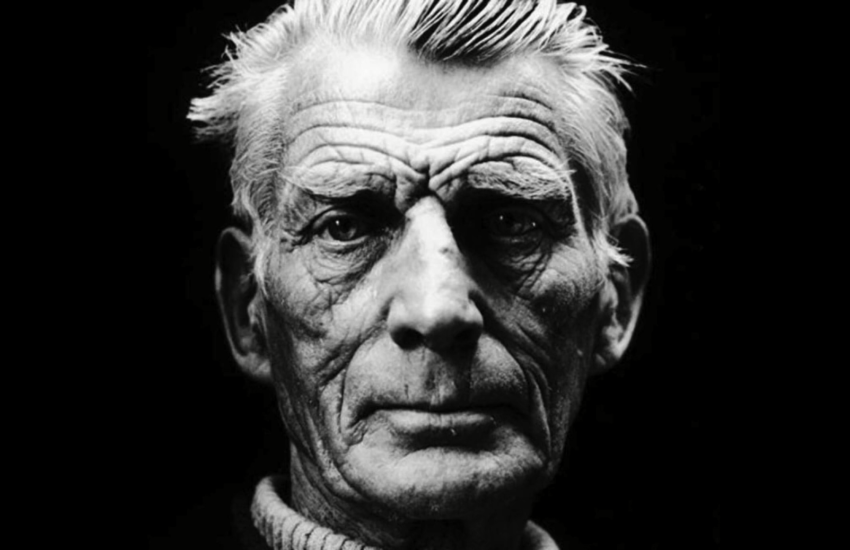Im Jahr 2015 urteilte Dustin Hoffman ziemlich desillusioniert: „Ich denke, das Fernsehen ist derzeit besser als jemals zuvor, und ich finde, der Film ist so schlecht wie noch nie – in den 50 Jahren, die ich das mache, war es nie schlimmer.“ Sein Kollege Kevin Spacey kam schon vorher zu dem Schluss, „dass das Fernsehen das Kino überholt habe“. Dann nahm er im TV die Rolle seines Lebens an, den Frank Underwood in „House of Cards“ und schrieb damit TV-Geschichte. Spacey wurde später wegen (angeblicher) sexueller Belästigung beschuldigt, flog umgehend aus dieser Serie, was aus einem famosen Fernsehereignis ein Einerlei machte, welches dann vom Bildschirm verschwand. Die Serie lief dennoch zu lang und verpuffte. Die grandiose Robin Wright, die als Claire Underwood ihrem Kollegen Spacey das Wasser reichen konnte, trug daran keine Schuld, sie mühte sich redlich, der alte Funke sprang einfach nicht mehr über. Die ersten drei Staffeln sind bis heute TV-Ereignis geblieben und sollten ihre Zuschauer nicht verlieren.

Serien, die über den Durchschnitt ragen, finden oftmals weder Ausgang noch ein befriedigendes Ende. Im schönsten Moment unter einer Erfolgsflagge aufzuhören ist nicht nur in der Kunst ein schweres Ding. Schauen wir, wie einige legendäre Highlights der TV-Geschichte sich an ihr Ende brachten.
Als die ABC 1977 „Washington: Behind Closed Doors“ in sechs Folgen auf dem Schirm bot, flimmerte den Leuten ein Politthriller der besonderen Art ins Haus. Die Serie basierte auf dem Buch „The Company“ von John Ehrlichman, einem der wichtigsten Berater von US Präsident Richard Nixon. In dieser Arbeitsteilung gehörte Ehrlichman natürlich zu den Watergate-Mittätern, landete später für 18 Monate im Knast und verlor seine Anwaltslizenz. Um Rechnungen bezahlen zu können, schrieb er „The Company“, ein durchschlagender Erfolg auf dem Buchmarkt und später in besagter Verfilmung. ABC hat zwecks Unterhaltung einiges an Beziehungs- und Herzthemen eingefügt. Man traute damals einem hundertprozentigen Politthriller noch nicht über den Weg. Diese Nebenstorys sind allesamt störend, trivial und blöd. Der politische Teil elektrisiert bis heute und zeigt Schauspielkunst auf großem Fuß. Jason Robards gibt grandios den Präsidenten Richard Monckton, der unverkennbar Richard Nixon. Ein zentraler Gegenspieler wird CIA-Chef William Martin, jener unverkennbar Richard Helms. Nixons besten Schildknappen, seinen Stabschef Bob Haldeman zeichnet Robert Vaughn unter dem Rollennamen Frank Flaherty als stahlnervigen Apparatschik mit Mephisto-Qualität. Robert Vaughn heimste dafür zurecht Schauspielerpreise ein. Die Geschichte endete wie im realen Leben. Während Nixon den Deal mit China bejubelt und sich für das politische Genie des Jahrhunderts hält, werden seine Einbrecher ins Hauptquartier des politischen Gegners erwischt. Da endet die Serie. Der Rest ist politisch denkenden Menschen geläufig, weil Geschichte. Fortsetzung unnötig. Die Serie hat in ihrem politischen Teil nichts an Stärke verloren, seziert Politik wie mit dem Skalpell. Wiedersehen mit diesem Werk lohnt jederzeit. (Notiz am Rande: Jason Robards, wohl jedermann aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ in der Rolle des Cheyenne im Gedächtnis, stellte übrigens 1976 in „All the President’s Men“ einen zentralen Nixon-Gegner dar, den Washington Post Chefredakteur Ben Bradley. In dieser Nebenrolle spielte er sogar die in Bestform agierenden Hauptdarsteller Dustin Hoffman und Robert Redford charismatisch an die Wand und bekam dafür einen verdienten Oscar.)

Als die BBC sich 1979 an „Tinker, Tailor, Soldier, Spy“ und 1982 an „Smiley’s People“ wagte, die Verfilmung der berühmten Spionageromane von John le Carré, spielte Alec Guinness den Helden unzähliger le Carré Romane, den britischen Spion George Smiley, so authentisch, dass le Carré eingestand, er könne diese Figur nie wieder aufleben lassen. Guinness würde von nun an immer vor seinem Auge stehen und hätte ihm diese Figur sozusagen geraubt. In der Schlussszene der letzten Staffel hat Smiley seinen alten KGB-Gegenspieler Karla besiegt und zum überlaufen an der Berliner Sektorengrenze gezwungen. Wie Alec Guinness dabei Triumph mit Melancholie bündelt und darstellt, ist Schauspielkunst von einem anderen Stern und wohl in dieser Form nur von einem solchen Ausnahmemimen zu leisten. Das Ende still und ohne Euphorie. Es ist einfach nur vorbei. Sieger dabei nicht besser als Verlierer und Schluss. Pathos wird vergebens gesucht.

HBO wagte sich mit dem Mafiaepos „The Sopranos“ 1999–2007 unter die Leute. In sechs Staffeln sah man den Mafiaboss Tony Soprano beim Morden, beim Familienfrühstück, im Strip-Club „Bada Bing“ und sogar regelmäßig bei einer Seelenklempnerin. Ein Familienvater mit aufbrausendem Temperament und guten Zigarren, der mit kühler Hand auch Verwandte ins Jenseits befördert. Der Darsteller James Gandolfini spielte sich mit dem Tony Soprano in die erste Reihe der US-Schauspielzunft. Bei den Sopranos war jeder Pate-Romantik gewichen. Hier trugen Mafioso billige wie peinliche Jogginganzüge, wirkten schmierig und oft viel zu fett mit obligater Goldkette, beklauten auch mal einen armen Gärtner oder erschossen einen Kellner wegen Trinkgeld. Der elegante Pate John Sacramoni fuhr immerhin Maserati, liebte abgöttisch eine äußerst übergewichtige Gattin und rauchte sich in Menge und Eleganz stilvoll wie Humphrey Bogart durch die Serie. Am Ende krepierte er elend an einem Lungenkarzinom im Krankentrakt eines Bundesgefängnisses. Tony Soprano dagegen hatte alle Mafiakriege mit Glück und Hartnäckigkeit überlebt. Sein Imperium dennoch fast verspielt. Viel Übles wartete auf ihn, ein Informant packte wohl demnächst aus. Dennoch schlenderte Tony mit Appetit in der letzten Szene in ein Steakhouse, freute sich auf Zwiebelringe, seine Frau und die beiden Kinder. Während er am Tisch Musik aussuchte, seiner Frau vom Informanten und drohender Anklage erzählte, dem Sohn ein Gericht empfahl, hatte die Tochter vor der Tür noch Einparkprobleme. Ein Gast von der Bar ging im Stil von Michael Corleone derweil auf die Toilette. Als die Soprano-Sippe vollständig versammelt plötzlich ohne Vorankündigung das große Dunkel und absolute Ruhe, der Bildschirm schwarz. Kein Laut, kein Bild, kein Hinweis. Nur noch der Abspann nach 8 Jahren und 86 Folgen. Ob Tony ein Steak aß oder eine letzte Kugel fing, die Drehbuchautoren ließen sich nichts mehr entlocken. Die riesige Soprano-Gemeinde wurde niemals aufgeklärt, jeder darf sich seinen Teil denken. James Gandolfini hatte die Rolle des Tony Soprano hinter sich gelassen und machte den Weg ins Kino. Auf dem Weg zu einem Filmfestival stoppte er im Sommer 2013 in Rom und schaute sich die Stadt an. Dabei ereilte ihn ein tödlicher Infarkt.

Game of Thrones (GoT) bewegte wohl den halben Globus. Fans rekrutierten sich wie Fliegen um die Frucht, die Serie wurde Kult und Gesprächsthema durch alle Tage ihrer Laufzeit. Als die Drehbuchautoren nicht mehr auf den Buchautor George R. R. Martin setzen konnten, dieser hielt mit dem Filmtempo nicht mit, begann ein spürbarer Niveauverlust, der zu diesem Zeitpunkt die süchtige GoT-Gemeinde längst nicht mehr störte. GoT hatte seine Neuerungen und muss dafür gelobt werden. Charaktere, die für Sympathie standen und vom Publikum gemocht, wurden schnell mal weggemeuchelt. Mit Tatkraft raffte GoT manchen Hauptdarsteller dahin. Ebenfalls sehr wohltuend, mancher der Helden starb einfach so, ohne noch einen Pieps oder gar philosophische Weisheiten von sich zu geben. Niemand von den Autoren kam nämlich auf die peinliche und branchenübliche Idee ihnen noch letzte Worte in den Mund zu legen. Was leider in Film und TV zu oft der unsägliche Fall. So starb der getreueste Wächter der Drachenkönigin in ihren Armen ohne einen Mucks. Dem Lord mit dem Flammenschwert entglitt beim Ableben ebenfalls kein Laut. Der schweigsame Unhold der Serie, ein Nachtkönig aus Eis und allerhand Zeug, zerbröselte unter einem Dolchstich wie billiges Porzellan, für einen Seufzer ward auch ihm keine Gelegenheit geboten. Eine Zauberin, die viele Binsenweisheiten plapperte, nahm zum Sterben nur die Halskette ab, war hinüber und sagte kein einziges Wort. Wenn die vielleicht spektakulärste Folge der Serie, die „Great Battle of Winterfell“ militärische Logik völlig auf den Kopf stellte, das Spektakel blieb erkennbar und die dort zelebrierte Stille des individuellen Ablebens in einem Meer unaufhörlichen Gemetzels wohltuend. Eine Familie siegte am Ende der Serie, weil sie irgendwie übrig geblieben und ging dann ihrer Wege. Jene sagenumwobene Drachenkönigin bekommt später auch noch einen Dolch in die königliche Brust und kann kaum noch komisch dreinschauen, für ein Wort reicht es auch bei ihr nicht mehr. Die merkwürdigste Figur, ein Kleinwüchsiger, dem Alkohol wie ein Säufer zusprechend, war Berater von allen und jeden. Sein Rat führte meistens ins Verderben, dennoch blieb er Berater über das Ende hinaus. Vielleicht eine ironische Spitze der Serienmacher gegen den Beraterwahn unserer Zeit. Nichts Genaues weiß man nicht. Das Unterfangen dieser Serie hat im Fantasy-Bereich Maßstäbe gesetzt, ähnlich dem Kino-Klassiker „Herr der Ringe“. George R. R. Martin und J. R. R. Tolkien sind Brüder im Geiste und haben Shakespeare, Stichwort Rosenkriege, eine Menge zu verdanken. „Game of Thrones“ und „The Lord of the Rings“ zu toppen wird viel Aufwand und Geld erfordern.

Ein eigener Planet im Serienuniversum war „Breaking Bad“. Walter White, der krebskranke Chemielehrer ohne Geld für eine Behandlung. Aus ihm wird in der Not der beste Chrystal Meth Koch unter der Sonne. Dabei wählt er das Pseudonym „Heisenberg“. Weil Heisenberg einer der berühmtesten Physiker der Wissenschaftsgeschichte, bleibt diese Namenswahl eines der Serienrätsel. Assistiert wird Walter White von dem schlechtesten Schüler seiner Lehrzeit, was der Serie einen netten Kick gibt. Nett ist ansonsten wenig. Es wird gemordet und geht brutal her. Bei der Drogenmafia ist Schluss mit lustig. Gemixt, gekocht und gebraut wird in hohem Tempo, der Markt will gesättigt sein. Geld häuft sich bei White und seinem Partner in Größenordnungen, welche am Ende so unüberschaubar, dass man kaum noch weiß, wie viel verdient wurde. Wie die Drogenbosse Tuco Salamanca und Gus Fring ins letzte Gras beißen oder der Killer Mike Ehrmantraut seinem Handwerk nachgeht, ist so vor „Breaking Bad“ auch noch nicht zu besichtigen gewesen. Irgendwann gesteht es Walter White auch der entnervten Ehefrau, alles, was er angerichtet, hätte er getan, um sich lebendig zu fühlen und nicht für Frau, Kind und Kegel. Eine sympathisch amoralische Aussage und kein moralinsaures Familiengesäusel. Bei seinem letzten Coup, das Serienende naht, baut Heisenberg ein MG, das aus einem Kofferraum springt und mit Dauerfeuer letzte Feinde eliminiert. Dabei trifft auch ihn ein Schrapnell. Damit schleppt sich White noch in ein Meth-Labor und betastet fast zärtlich die Gerätschaften seiner Triumphe. Mit einem leichten Lächeln und glücklichem Gesichtsausdruck sinkt er auf die Erde und stirbt friedlich. Ein Schluss, der nichts offenlässt. Gut getroffen im Sinne des Wortes. Bryan Cranston, der Schauspieler des Walter White, startete mit dieser Glanzrolle ähnlich durch wie James Gandolfini, gehört heute zur Crème de la Crème der Charakterschauspieler auf diesem Planeten.