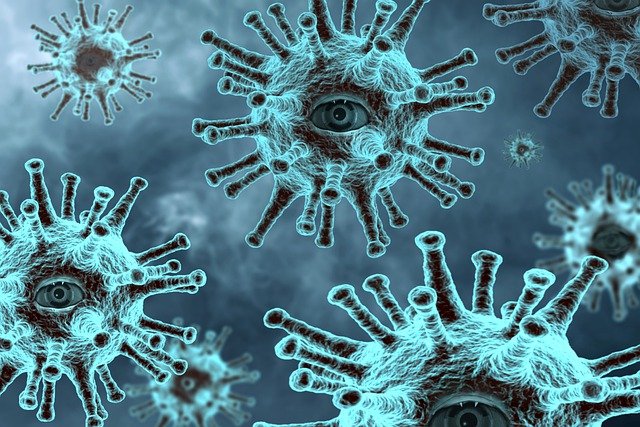Was waren das noch für Zeiten, als wir Furcht hatten vor dem „Weltbrand“ aus Nuklearraketen in den Arsenalen der Großmächte. Interkontinentalraketen mit zwei, drei, vier atomaren Sprengköpfen entfachten die große Angst. Tausende dieser Ungetüme standen in den Silos der Amerikaner und Russen. Selige Zeiten, in denen wir unseren Wohlstand mehrten und die Erde und andere Menschen ausbeuteten. Weltweit gibt es immer noch ca. 13.000 atomare Sprengköpfe. Dieses Arsenal reicht noch für einen gewaltigen und finalen Wums. Allerdings kratzt es keinen mehr. Längst juckt anderes in unserem Pelz. Vielleicht machen uns diverse Virusmutationen den Garaus, die wir noch nicht auf dem Schirm, bevor Klimaauswüchse uns braten, verbrennen, wegfegen oder ersäufen. Der Mensch hat aktuell so einiges an der Backe, frönt in der westlichen Hemisphäre dennoch dem „immer weiter so“.
Zwei durchaus beunruhigende Titelbilder europäischer Qualitätszeitungen könnten in 20 bis 30 Jahren als Vorbote einer Hölle gelten, der wir nichts entgegenzusetzen haben. Alle Alarmglocken läuten offenbar zu spät. Die Menschheit und jeder Einzelne von uns werden nichts mehr umkehren oder gar verhindern. Der Glaube an eine Umkehr funktioniert nur mit einem Höchstmaß an Naivität oder dem Lieblingsmittel des Menschen „Kopf in den Sand“ und dem „Prinzip Hoffnung“. Die Gefahr besteht übrigens nicht für den Planeten. Da sollten wir uns nicht täuschen. Die Erde existiert noch weiter, wenn es längst auf ihr kocht oder alles im ewigen Winter oder Wasser verschwindet.


Die Gefahr besteht für uns und eine Menge unschuldiger Lebewesen aus dem Tierreich. Darunter nicht die Kellerassel, die soll angeblich sogar einen radioaktiven Niederschlag überstehen können und dabei weiter prächtig gedeihen. Na wenigstens das. Wir dagegen haben mit unserer Art Lebensmodell die Büchse der Pandora geöffnet, sind die große Plage auf diesem Planeten, die einzigen Macher jener Gefahr, die uns nun gnadenlos im Nacken sitzt. Oben wird weiter Gier und Habgier obsiegen. Unten wird man nach wie vor danach dürsten, mit 10.000 anderen Freizeitbegierigen auf einem dicken Dampfer Venedig anzusteuern oder einen Zentner Grillfleisch für 2 Euro kaufen, regelmäßig und billig in eine Erholung fliegen zu können, die vielleicht bald keine mehr ist. Wer will wirklich auf sein Auto verzichten? Die Menschen kennen längst von allem den Preis aber von nichts mehr den Wert.
Das alte Indianersprichwort wird der nachfolgenden Generation wie ein Menetekel näher und näher rücken: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ In diesem Sinne kann man uns allen nur viel „Spaß“ beim Tanz auf dem Vulkan wünschen, zu dem die Musik längst aufspielt. Allerdings will dies kein Aas hören. Man könnte hierzu noch Jonathan Franzen, den US-Schriftsteller ins Feld führen, der mit scharfem Blick Menschen, Natur und das Leben seit Jahrzehnten im Auge hat. Auch die Beschwörungen der Politik sind ihm nicht fremd. Im September 2019 schrieb er im „New Yorker“ ein Essay* zum Thema. Der Titel deutlich: „Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen?“ Franzen weiter: „Es ist nicht fünf vor zwölf, was wir seit 20 Jahren erzählen, sondern fünf nach zwölf. Das Spiel ist aus, wir werden den Klimawandel nicht mehr kontrollieren, die Katastrophe nicht verhindern können. Das Pariser Abkommen, das Zwei-Grad-Ziel, „Fridays for Future“, die Bepreisung von CO₂: alles zu spät, nachdem 30 Jahre lang vergeblich versucht wurde, die globale Erwärmung zu reduzieren. Wir sollten der Wahrheit ins Gesicht sehen.“ Auf Schriftsteller wird auf diesem Planeten allerdings grundsätzlich äußerst wenig gehört. Denen geht es wie den Indianern mit ihren Weisheiten.

In vielen Untergangsszenarien wird gern die Titanic aufs Trapez gebracht. Dort spielte die Kapelle noch, bis das kühle wie eisige Nass die Knöchel umspülte. Stilvoller Abgang. John Astors Leiche trieb da schon wenig stilvoll im Atlantik und konnte später anhand von 4.000 Dollar identifiziert werden, die er sich in die Tasche gesteckt hatte. Reichtum hat also in der Tat Vorteile, selbst wenn es in die ewigen Jagdgründe geht. Da sind wir schon wieder bei den Indianern.
Wer noch Hoffnung für die Zukunft hegt oder hegen muss, weil er dort etwas zu bestellen, der sollte sich auf die Spur des Journalisten George Monbiot machen. Jener twittert fleißig und geistreich, ist außerdem Kolumnist beim Guardian. Niemand schreibt fundierter und engagierter über den Zustand des Planeten und dessen Gefährdungen durch Raubbau, Mensch, Wirtschaft und Politik. Übrigens alles in einer verständlichen Art und Weise, nicht für den wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Man ist gut bei ihm aufgehoben und deshalb sei er hier wärmstens und ernsthaft empfohlen.
*Jonathan Franzens Essay liegt als Rowohlt Taschenbuch (8 Euro, 64 Seiten) auch in deutscher Sprache vor.